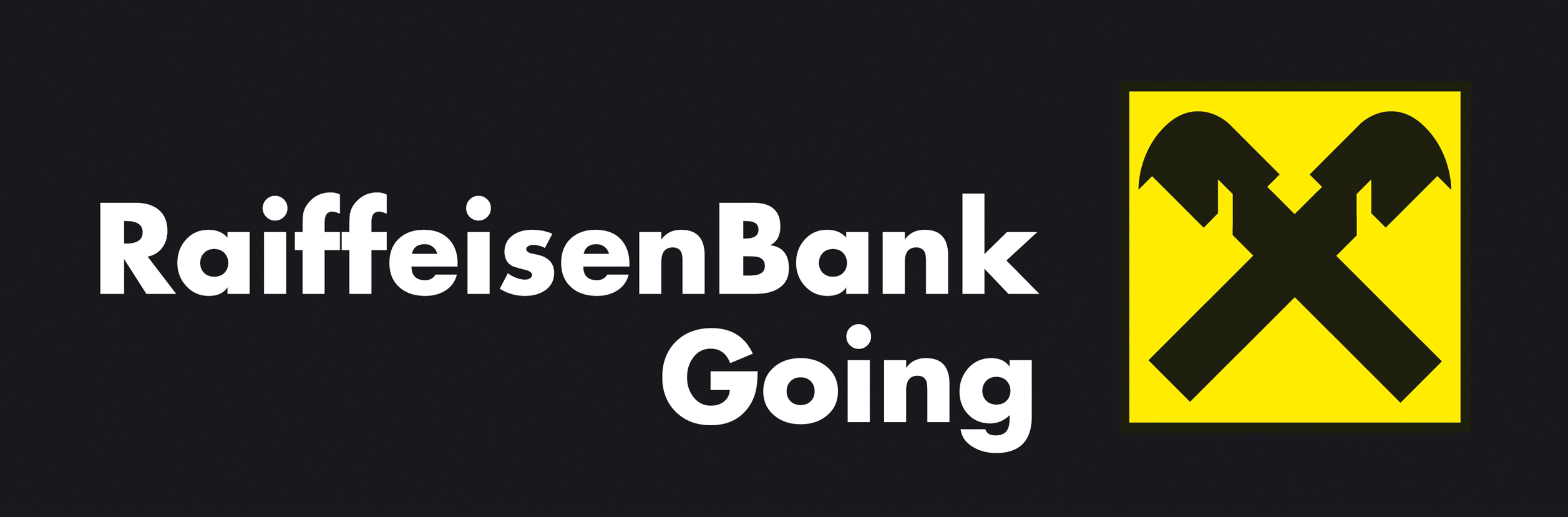Dienstbarkeiten oder auch Servitute genannt, sind entsprechend dem Sachenrecht in Österreich beschränkte, dingliche Nutzungsrechte an fremden Sachen, deren Eigentümer verpflichtet ist, etwas zu dulden oder zu unterlassen. In dieser Definition liegt der Unterschied zur Reallast, bei welcher etwas aktiv gemacht werden muss. Dienstbarkeiten sind etwa das Recht einen Weg zu benutzen oder das Fruchtgenussrecht.
„Beschränkt“ bedeutet, dass eine Dienstbarkeit nur für denjenigen gilt, der im Wortlaut des Dienstbarkeitsvertrages ausdrücklich als Berechtigter bezeichnet ist, „dinglich“, dass die im Grundbuch eingetragenen Rechte gegenüber jedermann wirken, und zwar unabhängig davon, ob man Kenntnis von der Dienstbarkeit hat oder nicht.
Wo sind Dienstbarkeiten geregelt?
Geregelt sind die Dienstbarkeiten im ABGB (Allgemein bürgerliches Gesetzbuch) aus dem Jahr 1812 und hier in den §§ 472, 473 ABGB:
- 472 ABGB: Durch das Recht der Dienstbarkeit wird ein Eigentümer verbunden, zum Vorteile eines Andern in Rücksicht seiner Sache etwas zu dulden oder zu unterlassen. Es ist ein dingliches, gegen jeden Besitzer der dienstbaren Sache wirksames Recht.
- 473 ABGB: Wird das Recht der Dienstbarkeit mit dem Besitze eines Grundstückes zu dessen vorteilhafteren oder bequemeren Benützung verknüpft; so entsteht eine Grunddienstbarkeit; außerdem ist die Dienstbarkeit persönlich.
Man unterscheidet zwischen Grunddienstbarkeit und Personaldienstbarkeit. Von Grunddienstbarkeit spricht man, wenn der Grundeigentümer einer bestimmten Liegenschaft der Berechtigte ist, von einer Personaldienstbarkeit dann, wenn durch die Dienstbarkeit eine bestimmte Person berechtigt wird.
Grunddienstbarkeit z.B. Geh- und Fahrrecht, Baurecht, Baubeschränkung oder Bauverbot, Recht einen Brunnen anzulegen, Leitungen zu verlegen, Vieh zu treiben, Holz zu transportieren, etc..
Personaldienstbarkeit z.B. Wohnungsgebrauchsrecht, Fruchtgenussrecht, etc..
Wie wird eine Dienstbarkeit begründet?
- Rechtsgeschäft/Vertrag:
Es sind Titel und Modus erforderlich. Als Titel kommen Rechtsgeschäfte (Dienstbarkeitsvertrag) aber auch gesetzliche Tatbestände (z.B. Ersitzung) in Frage. Modus ist die Art der Übertragung des Dienstbarkeitsrechtes, z.B die Eintragung der Dienstbarkeit ins Grundbuch.
Dienstbarkeiten müssen immer in das Grundbuch eingetragen werden (Eintragungsgrundsatz) und sie entstehen auch erst als dingliches Recht mit der Eintragung ins Grundbuch. Falls eine Dienstbarkeit „offenkundig“ (z.B. eine Zufahrtsstraße) – daher leicht erkennbar ist – muss sie der Erwerber eines Grundstückes gegen sich gelten lassen, auch wenn diese Dienstbarkeit nicht im Grundbuch eingetragen ist.
Der Eintragung ins Grundbuch geht der Dienstbarkeitsvertrag voraus, welcher von den Parteien beglaubigt von einem Notar oder vom Legalisator (wenn alle Parteien ihren Hauptwohnsitz in der selben Gemeinde haben) zu unterfertigen ist. Im Vertrag sollte die Art und der Umfang des Rechtes genauestens festgelegt werden, d.h. ob durch den Vertrag lediglich ein Geh- oder ein Fahrrecht eingeräumt wird, ob dies nur zum Zweck der land- und forstwirtschaftlichen Bewirtschaftung oder zu jedem Zweck ausgeübt werden kann. Weiters sollte der Verlauf und die Breite des Servitutsweges, am besten mit Hilfe einer genauen Skizze, sowie diejenigen Personen, zu deren Gunsten die Dienstbarkeit eingeräumt worden ist, im Vertrag angeführt werden.
- Ersitzung:
Die Ersitzung einer Dienstbarkeit ist sehr umfangreich und bedeutsam, insbesondere im Bereich der Wegservituten, vor allem im ländlichen Bereich. Für die Ersitzung eines Weges müssen gewisse Voraussetzungen erfüllt sein. Eine Voraussetzung gegenüber natürlichen Personen (Eigentümer der dienenden Liegenschaft) ist die faktische, uneingeschränkte und ungehinderte Ausübung der Benützung des Weges über einen Zeitraum von über 30 Jahren, gegenüber juristischen Personen des öffentlichen und privaten Rechtes sowie den Kirchen eine 40-jährige Ausübung. Die Benützungsdauer muss der Ersitzungswerber beweisen (meist durch Zeugen). Als zweite Voraussetzung wird die gutgläubige Ausübung gefordert. Gutgläubig ist derjenige, der aus wahrscheinlichen Gründen die Sache, die er besitzt für die seinige hält. Eine Person ist somit als gutgläubig anzusehen, wenn sie glauben kann, dass ihr das Recht der Benützung zusteht – dies ohne Bewilligung oder Zustimmung. Derjenige der die Ersitzung bzw. das Wegerecht bestreitet muss beweisen, dass der Ersitzungswerber nicht gutgläubig ist.
Weitere Begründungen einer Dienstbarkeit sind durch Testament oder durch richterliche Entscheidung möglich, wobei bei der richterlichen Entscheidung, das Gericht jedoch nicht von Amts wegen tätig wird, sondern nur durch Klage eines Betroffenen. Außerdem kann durch Gerichtsurteil auch ein „Notweg“ begründet werden.
Ausübung einer Dienstbarkeit?
Die Dienstbarkeit muss möglichst schonend und einschränkend ausgeübt werden, eine eigenmächtige Erweiterung ist nicht zulässig. Diese eigenmächtige Erweiterung liegt dann vor, wenn die Belastung für das „dienende“ Grundstück erheblich vergrößert wird. Die Instandhaltung obliegt dem Berechtigten.
Wie erlöscht eine Dienstbarkeit?
Eine im Grundbuch eingetragene Dienstbarkeit kann nicht ohne weiteres aufgelöst werden. Eine Dienstbarkeit wird ungültig oder erlöscht durch:
- den Untergang der dienenden Sache
- durch Verzicht bzw. Einvernehmen
- durch gutgläubigen Erwerb (siehe oben)
- durch Enteignung
- sowie in manchen Fällen durch Zeitablauf
Dieser Artikel erhebt keinesfalls den Anspruch auf Vollständigkeit, sondern soll nur ein einfaches Wissen über Dienstbarkeiten vermitteln. Das Recht der Dienstbarkeiten ist umfangreich und sehr komplex. Genau aus diesem Grund sollten sie bei Fragen zu Dienstbarkeiten einen Anwalt für Vertragsrecht betrauen, damit dieser einen für sie angepassten/individuellen Dienstbarkeitsvertrag (Dienstbarkeit – Entgelt – Kosten – Grundbuch – etc.) erstellt.
Weitere Beiträge:
Immobilienertragssteuer (ImmoEST)
Zu Beginn meines ersten Artikels im Newsletter der Raiffeisenbank Going eGen, darf ich mich als langjähriger Funktionär der Raiffeisenbank Going eGen und als Rechtsanwalt in Söll kurz vorstellen, und möchte mich gleichzeitig bei der Geschäftsleitung der Raika Going...
Grunderwerbsteuer
Jeder Erwerb einer Immobilie, sei es beispielsweise der Ankauf eines unbebauten Grundstücks zur Errichtung eines Eigenheims, der Erwerb einer Wohnung oder eines Einfamilienhauses, aber auch die Übertragung des Elternhauses auf die nächste Generation ist – neben dem...
Der (sichere) Weg zu den eigenen 4 Wänden – so geht’s richtig!
Der Kauf einer Immobilie, sei es eines Eigenheims, einer Wohnung oder eines Bauplatzes zur Errichtung eines Eigenheimes, birgt eine Vielzahl von (vermögens)rechtlichen Gefahren und muss daher sicher geplant und durchgeführt werden, geht es doch bei einer derartigen...